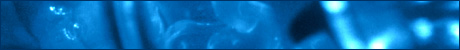Altes Museum: Chinesische Kunst aus fünf Jahrtausenden: Eine herausragende Ausstellung wurde in Berlin eröffnet.
Von Barbara Möller
[image]
Eine Wu-Tsai-Vase mit Hals in Knoblauchform und Blumen-, Drachen-
und Vogelmotiven aus der Ming-Dynastie (1573 - 1620). Foto: ddp
Berlin - Wenn je eine Ausstellung ein Politikum war, dann diese, die unter dem Titel "Schätze der Himmelssöhne" daherkommt. Um sie möglich zu machen, hat der Deutsche Bundestag 1998 das "Kulturgutsicherungsgesetz" verabschiedet. Es wird verhindern, dass die Volksrepublik China in Deutschland Hand auf das legt, was sie nicht ganz zu Unrecht für ihr Eigentum hält.
400 einzigartige Stücke aus der Kunstsammlung der chinesischen Kaiser sind jetzt im Alten Museum zu Berlin zu sehen. In Schinkels klassizistischen Räumen, die eigens in "Kaisergelb" gestrichen wurden, einem sanften Mais-Ton, der die Bronzen und Jaden, die Porzellane, Tuschebilder und Kalligraphien wunderbar zum Leuchten bringt.
Es sind 400 der 650 000 Objekte, die 1933 in Peking in 19 557 Kisten verpackt wurden und eine in der Kunstgeschichte beispiellose Odyssee antraten. Auf der Flucht vor den Japanern, die bereits die Mandschurei erobert hatten, und vor Mao Tse-tungs Kommunisten, die sich anschickten, die Macht in China zu übernehmen.
1948, mitten im chinesischen Bürgerkrieg, wurde ein Teil der Sammlung zum letzten Mal auf dem chinesischen Festland ausgestellt. In Nanking. Unter dem Schutz von Chiang Kai-shek, der sich ein Jahr später nach Taiwan absetzte. Mit den Kisten aus dem Pekinger Palastmuseum. 1965 hat man dann in Taipeh das Nationale Palastmuseum eingeweiht, in dem die "Schätze der Himmelssöhne" nach 32-jähriger Irrfahrt ein neues Zuhause fanden, und seit 1965 fordert die Volksrepublik China selbstverständlich ihre Herausgabe.
"Nur Kunstvolles ist von Bedeutung." Nichts könnte die Klasse der Berliner Ausstellung besser in Worte fassen als ein Mottosiegel des Kaisers Kao-tsung aus dem 18. Jahrhundert. Schon das erste Exponat ist eine Sensation. Mindestens 5000 Jahre alt, wirkt es archaisch und modern zugleich: Mit zeitlos geraden Linien ist der daumenhohe Vogel aus dem grünen Nephrit herausgearbeitet, die rot-brauen Einschlüsse vertiefen den seidigen Schimmer der Jade ins Unnahbar-Geheimnisvolle. Schöner, eigenwilliger kann Kunst kaum sein.
Im chinesischen Kaiserreich, das 221 vor Christus entstand und 1911 mit der Entmachtung von P'u-yi zusammenbrach, war der Monarch der "Himmelssohn", und folglich galten alle Dinge unter dem Himmel als sein persönliches Eigentum. Was P'u-yi glauben ließ, er sei berechtigt, die Schatzkammern seiner Vorfahren über die eigene Thronenthebung hinaus nach Gutdünken zu plündern. Jahrelang verscherbelte der Letzte aus der Ch'ing-Dynastie Hunderte von Kalligraphien, Berge von Porzellan und Porträts seiner kaiserlichen Ahnen - bis ihn die Revolutionäre 1924 aus der Stadt jagten.
Schwamm über diesen elenden Mann, zitieren wir lieber den edlen Ch'ien-lung, der den ersten Katalog der kaiserlichen Kalligraphie- und Gemäldesammlung 1744 mit diesen Worten in Auftrag gab: ". . . haben sich Schriftrollen und Gemälde des Palastes . . . zu Abertausenden angehäuft. Es gebührt sich nicht, sie nicht mit Ehrfurcht sorgfältig aufzubewahren, um sie den Söhnen und Enkeln zukommen zu lassen." Diese Haltung entsprach viel mehr den auf Ewigkeit angelegten Perspektiven der Himmelssöhne, die von Anfang an ihre Sammlungen erweiterten, denen das Beste gerade gut genug war.
Zu den Höhepunkten der Ausstellung gehört das älteste Wörterbuch der Welt: "Erh Ya". Was so viel bedeutet wie "Fortschritt zur Korrektheit" und das Ringen der hochgebildeten Kaiser um die Auslegung der Lehren des Konfuzius belegt. "Erh Ya" entstand um 200 v. Chr. und ist in Berlin in der ältesten erhaltenen Abschrift zu sehen, einer Kostbarkeit aus dem 12. Jahrhundert.
Überhaupt ist die Schau von der Schrift geprägt. Im Gegensatz zu Europa ist die Kalligraphie in China - wie auch in Japan - ja die Kunstgattung, die die allerhöchste Wertschätzung genießt. Deshalb war die höfische Kultur immer auch eine Literatenkultur. Und die Kaiser dichteten nach Kräften mit. Allein auf Tsou Yi-kueis hochberühmter Hängerolle mit den Aprikosenblüten hat sich Kao-tsung im Lauf von 37 Jahren mit vierzehn Gedichten verewigt. Wie pflegte der Kaiser zu sagen? "Der Pinsel fließt, der Pinsel fliegt und füllt so manche Rolle."
Einen, von dem solcher Ehrgeiz nicht überliefert ist, zeigt eins der schönsten Kaiserporträts: Ning-tsung, dessen Antlitz die Wahrsager mit dem "Ebenbild eines uralten Drachens" verglichen. Was bewundernd gemeint war. Für dieses hinreißende Gemälde aus dem frühen dreizehnten Jahrhundert gilt übrigens dasselbe wie für fast alle Exponate: Es wirkt in seiner Schlichtheit umwerfend modern.
Berlin stiehlt Bonn die Schau
Knapp zwanzig Jahre ist es her, dass sich das Pekinger Palastmuseum in Berlin mit der grandiosen Ausstellung "Schätze aus der Verbotenen Stadt" präsentierte.
Jetzt betritt Taipeh die Hauptstadtbühne, obwohl oder gerade weil die Bundesrepublik Taiwan die Anerkennung aus Rücksicht auf die Volksrepublik China nach wie vor verweigert.
Eigentlich sollten die "Schätze der Himmelssöhne" nur in der Bundeskunsthalle in Bonn gezeigt werden. So hatte man es vor zehn Jahren verabredet. Erst im Zuge der Vorbereitungen hat den Taiwanesen dann offenbar gedämmert, dass Bonn nicht Berlin ist, jedenfalls verlangten sie 1998 plötzlich, die Ausstellung müsse auch in Berlin zu sehen sein.
In Bonn war man verschnupft, in Berlin gab es ein längeres Hin-und-Her wegen des Ausstellungsortes, bis schließlich die Staatlichen Museen zugriffen.
Deren Generaldirektor Klaus-Peter Schuster hat bei der Eröffnung übrigens elegant gesagt, "natürlich" gehörten diese Schätze der gesamten Menschheit.
Die Bonner Organisatoren, die die ganze Arbeit (vor allem die diplomatische) gemacht haben, müssen nun damit leben, dass ihnen Berlin die Schau stiehlt.
Am Rhein zeigt man die Schätze aus Taipeh vom 21. November bis zum 15. Februar.
BaM